Willkommen bei den FRÜHEN HILFEN
Diese Website informiert über die Frühen Hilfen in Österreich. Die Suche ermöglicht einen einfachen Zugang zum Angebot. Die Website bietet auch Informationen zur Lebensphase der Schwangerschaft und frühen Kindheit und stellt Materialien und Videos zur Verfügung.
Frühe Hilfen stehen Ihnen und Ihrer Familie zur Seite und unterstützen Sie dabei, die richtige Hilfe zu bekommen.
Für werdende Eltern und Familien mit Kindern von 0 - 3 Jahren
freiwillig + vertraulich + kostenlos + gerne auch zu Hause
Nehmen Sie Kontakt auf!
Wohnbezirk der Familie: (Name des Bezirks oder PLZ)Wir unterstützen Sie, wenn

zum Beispiel:
- in der Schwangerschaft unerwartete Veränderungen auftreten
- wenig Unterstützung vom Partner oder der Partnerin und im familiären Umfeld da ist
- das Kind mehr Aufmerksamkeit braucht, als Sie geben können
- das Geld nicht mehr reicht
- es einem Familienmitglied psychisch schlecht geht
- das tägliche Zusammenleben in der Familie schwierig ist
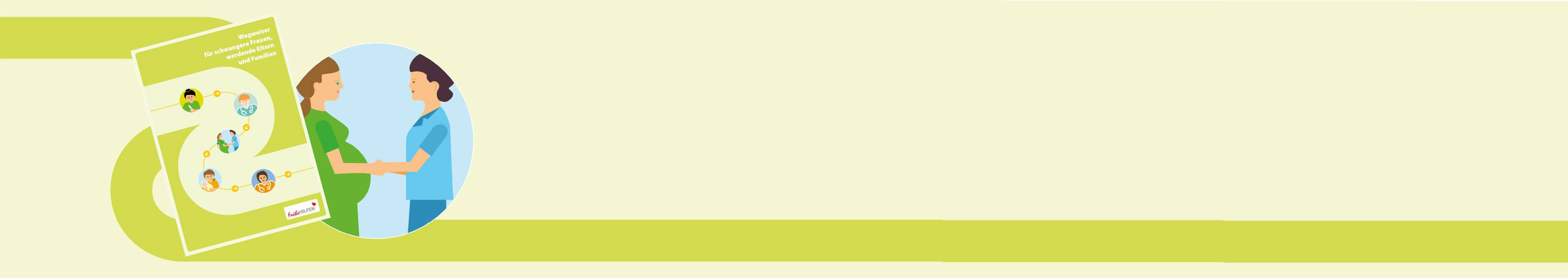
Wegweiser für schwangere Frauen, werdende Eltern und Familien
Infos für Fachleute
Auf der Website des Nationalen Zentrums Frühe Hilfen (NZFH.at) finden Sie Fachinfos zum Konzept der Frühen Hilfen, Informationen zu den Aktivitäten des NZFH.at, Publikationen und Materialien für Fachleute, Hinweise auf Veranstaltungen und Fortbildungen und können sich für die News zu Frühen Hilfen anmelden.
